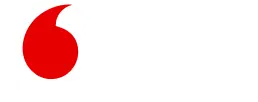Thomas Engel greift zu einem ungewöhnlichen Hilfsmittel, um seine Ehefrau Gabriele ins Wasser des Riemer Sees zu bringen. Er setzt die 55-Jährige in eine faltbare Schubkarre. Mit Schwimmnudeln aus Schaumstoff und der Hilfe ihres Mannes kann sie an der Oberfläche des Sees treiben, der nicht weit von ihrer Wohnung im Münchner Osten liegt.
Gabriele Engel kann die meisten ihrer Muskeln nicht mehr bewegen. Die unheilbare Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hat die Nerven zerstört, die Bewegungssignale an die Muskelzellen übermitteln. Auch ihre Zunge ist gelähmt. Ihre Arbeit als Beamtin im gehobenen Dienst musste sie schon vor längerer Zeit aufgeben. Sie benutzt einen Computer, der Bewegungen der Augen in Sprache übersetzt, um ihre Erinnerung an den Badeausflug zu formulieren: «Wir genießen die schönsten Momente.»
Lebensqualität bewahren
Der Medizinprofessor Paul Lingor vom Klinikum rechts der Isar der TU München kennt viele Patienten, bei denen die Krankheit verläuft wie bei Gabriele Engel. Es gebe fast vollständig gelähmte ALS-Patienten, die mit Augensteuerung sogar noch eingeschränkt arbeitsfähig sind. «Wenn es um geistige Leistungen geht, ist vieles möglich», erklärt Lingor. Und er ist sicher, dass viele Patienten ihr Leben als lebenswert empfinden.
Aber Lingor fügt auch hinzu: Kranke wie der weltbekannte Physiker Stephen Hawking, der rund ein halbes Jahrhundert mit der ALS-Diagnose lebte, bevor er im Alter von 76 Jahren starb, sind eine seltene Ausnahme. «Die durchschnittliche Lebenszeit sind drei bis fünf Jahre nach Symptombeginn», erklärt Lingor. Es gebe keine gut wirksamen Medikamente, die die Krankheit aufhalten oder gar heilen könnten. Noch nicht einmal die Ursachen von ALS seien in der Wissenschaft wirklich verstanden.
Krankheit im Abseits
Der Forscher und Arzt ist überzeugt: «Man könnte die Lebensqualität von ALS-Patienten deutlich verbessern, wenn man mehr Ressourcen in die Forschung und auch in die Versorgung stecken würde.» Und Lingor betont: ALS ist selten, aber nicht so selten, wie viele Menschen denken. Auf die Lebenszeit gerechnet, erkrankt laut Lingor in Deutschland einer von 400 Einwohnern an der tödlichen Lähmung.
Vor zehn Jahren habe es für einige Wochen zwar eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit für die Krankheit gegeben, erinnert sich Lingor. Damals ging von den USA aus die sogenannte «Ice-Bucket-Challenge» um die Welt: Gesunde sollten sich einen Kübel Eiswasser über den Körper schütten und möglichst Aufnahmen davon im Internet verbreiten. Auch Geld sollte gespendet werden. Doch nach dieser Aktion sei die Aufmerksamkeit für ALS wieder abgeflacht und nach Lingors Einschätzung auch das Spendenaufkommen etwa für Selbsthilfegruppen.
Stigmatisierte Patienten
Der Mediziner erlebt auch immer wieder, dass Patienten ausgegrenzt werden. Menschen, die sich nicht mehr alleine anziehen oder nur mit Hilfe essen können, machten Erfahrungen, «die extrem stigmatisierend sind», weiß er. Auch Thomas Engel kann von irritierten Blicken berichten, wenn er mit seiner am ganzen Körper gelähmten Frau im Rollstuhl in einem Restaurant ist. Es komme vor, dass ihr Essen aus dem Mund fällt oder Speichel die Wange herunterläuft. Er wische das dann ab, sagt Engel. «Wer sich davor ekelt, muss sich eben woandershin setzen», stellt er klar.
Auch Jana Richter, deren Ehemann an ALS gestorben ist, hat Enttäuschungen im Umgang mit Gesunden erlebt. Sie erinnert sich daran, wie ihr Mann auf der Straße stürzte. Passanten ließen Richter merken, dass sie ihren Mann für schwer betrunken hielten und gingen vorbei, ohne zu helfen.
Selbsthilfe professionalisiert sich
Richter ließ sich von solchen Erfahrungen nicht entmutigen. Sie hat die ALS-Hilfe Bayern mit ins Leben gerufen. Die Selbsthilfe-Organisation, die bis jetzt auf rein ehrenamtlicher Basis gearbeitet hat, kann demnächst ihre Beratungsarbeit zum Teil professionalisieren. Ab Oktober finanziert die Fernsehlotterie für drei Jahre zwei halbe Stellen. Die Mitarbeiter sollen Patienten und ihre Angehörigen beraten, wie sie mit der Diagnose ALS umgehen können.
Lange Entscheidungswege
Dass Beratung für ALS-Patienten ausgesprochen wichtig sein kann, hat Alexander Necker erlebt. Anders als Gabriele Engel kann er noch sprechen, die Arme und Beine des 58-Jährigen aus Fürstenfeldbruck sind allerdings gelähmt. Auf die Frage nach seinem Beruf antwortet Necker: «IT-Fuzzi». Er kennt sich damit aus, online Informationen zu sammeln. Es gebe verschiedenste Rollstühle, Pflegebetten oder Kräne, erzählt er: «Wahnsinnig viele Hilfsmittel, mit einem Nachteil: Kein Mensch sagt dir, wie und wo du sie kriegen kannst.» Seine Krankenkasse habe Anträge in der Regel bewilligt. Doch die Entscheidungen hätten oft viel zu lange gedauert.
Auch Thomas Engel hat immer wieder die Erfahrung gemacht: Wenn er bei der Kasse zu erklären versuchte, dass seine Frau in einigen Monaten mit großer Sicherheit einen Rollstuhl brauchen wird, hieß es: Der Antrag könne erst dann gestellt werden, wenn sie das Hilfsmittel tatsächlich braucht. Gabriele Engel fasst es über ihren Sprachcomputer in zwei Worte: «Ein Kampf.»
Leben bis zum Schluss
Das Ehepaar Engel teilt dabei mit Alexander Necker eine Einschätzung: ALS ist eine niederschmetternde Diagnose, aber keine, die einem den Lebensmut rauben muss. «Die Krankheit ist absolute Kacke, sie macht brutal Angst», formuliert es Necker. Und er fügt hinzu: «Aber ich möchte raus, den Wind spüren, die Sonne, vielleicht auch ein bisschen Regen. Denn letztendlich: Hey, ich lebe noch, ich bin noch da.»