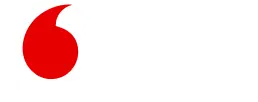Indigene auf der ganzen Welt sind so etwas wie das Frühwarnsystem für den Klimawandel: Da die Urvölker in Afrika, Asien, im Südpazifik und Lateinamerika häufig eng mit der Natur verbunden leben, spüren sie die Folgen der Erderwärmung als Erste.
Aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse über die Ökosysteme, in denen sie leben, gelten sie nach Einschätzung von Experten auch als Schlüssel im Kampf gegen den Klimawandel.
Hüter großer Waldgebiete und Ökosysteme
Wo indigene Gemeinschaften beispielsweise über verbriefte Rechte auf ihr Land verfügen, werden laut einer Studie der Welternährungsorganisation (FAO) deutlich weniger Flächen abgeholzt als in anderen Gebieten.
«Indigene Völker sind wichtige Akteure, denn obwohl sie nur fünf Prozent der weltweiten Bevölkerung ausmachen, verwalten sie rund 80 Prozent der weltweiten biologischen Vielfalt und sind die Hüter großer Waldgebiete und Ökosysteme, die für das Wohlergehen des Planeten entscheidend sind», sagt Germán Freire von der Weltbank.
Schwere Dürren und steigende Meeresspiegel, Abholzung und Zerstörung ihres Lebensraums, Umweltverschmutzung und Wetterextreme - die Herausforderungen für indigene Gruppen sind vielfältig. Hier einige Beispiele, welchen Gefahren die Urvölker ausgesetzt sind, und wie sie damit umgehen:
Zu viel Wasser: Neue Heimat wegen steigender Meeresspiegel
Wegen der drohenden Überflutung infolge des steigenden Meeresspiegels wurden die Bewohner einer kleinen Insel in Panama im vergangenen Jahr auf das Festland umgesiedelt. Rund 1.350 Menschen der indigenen Volksgruppe der Guna zogen in die neu gebaute Siedlung Nuevo Cartí an Panamas Nordküste. Der Exodus der Guna gilt als einer der ersten durch den Klimawandel erzwungenen Umsiedlungen in Lateinamerika.
Die Insel Gardí Sugdub («Krabbeninsel») liegt rund zwei Kilometer von der Atlantikküste Panamas entfernt. Experten gehen davon aus, dass sie bis 2050 wegen des Klimawandels komplett versinken dürfte.
Auch im Südpazifik werden sich die Bewohner von Inselgruppen wie Tuvalu, Kiribati oder Fidschi bald eine neue Heimat suchen müssen. Speziell das nordöstlich von Australien liegende Tuvalu wird in den nächsten Jahrzehnten weitgehend überschwemmt werden. Australien kündigte im vergangenen Jahr an, betroffene Menschen aus dem Südseestaat aufzunehmen und ihnen ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu gewähren.
Klimawandel bedroht traditionelle Nahrungsquellen der Indigenen
Die Gemeinschaft von Walande auf den Salomonen südöstlich von Neuguinea musste bereits vor Jahren umziehen. Bis dahin lebten die 800 Indigenen auf einer kleinen Insel vor der Küste. Nach verheerenden Springfluten im Jahr 2009 siedelten alle Bewohner auf das Festland über. Aber auch dort ist das Volk nicht sicher, wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) zuletzt warnte. «Am neuen Standort bricht Meerwasser durch die schützenden Deiche», hieß es in einem Bericht.
Auch die traditionellen Nahrungsquellen sind bedroht: Gärten und Felder werden einfach weggespült, und es gibt immer weniger Fische. «Walandes Geschichte ist eine Warnung, dass Gemeinden die Klimakrise nicht allein bewältigen können», sagte Erica Bower, Expertin für Klimavertreibung bei HRW. Die Regierung stehe in der Pflicht, den Betroffenen zu helfen.
Zu wenig Wasser: Hirtenvölker in Afrika fliehen vor Dürre
In Ostafrika hingegen fehlt es an Wasser: Hirtenvölker wie die Massai, Turkana, Samburu und Borana müssen aufgrund anhaltender Dürren und unregelmäßiger Regenfälle ihre traditionellen Weidegebiete verlassen. Nach Angaben der Weltbank führten klimatische Bedingungen in der Region 2021 und 2022 zum Tod von mehr als zehn Millionen Nutztieren.
Laut der Beobachtungsstelle für Binnenvertreibung (IDMC) wurden 2022 allein in Somalia, Kenia und Äthiopien rund 2,1 Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen. Zudem seien zahlreiche Hirtenfamilien gezwungen, ihren nomadischen Lebensstil aufzugeben und in Städte zu ziehen.
Um die Klimaflucht der Hirtenvölker einzudämmen, zielen verschiedene Initiativen am Horn von Afrika darauf ab, degradierte Böden durch nachhaltige Weidetechniken und Aufforstung wiederherzustellen. Um Dürreperioden zu überbrücken, werden Wasserquellen durch den Bau von Regenwasserauffangsystemen und Dämmen geschützt. Auch gibt es Projekte zur Diversifizierung von Einkommensquellen für Hirten, beispielsweise durch den Anbau dürreresistenter Nutzpflanzen oder die Verarbeitung von Milchprodukten.
Traditionelle Lebensformen in Gefahr
Steigende Temperaturen sowie Dürren in der Kalahari-Wüste in Südafrika, Namibia und Botsuana bedrohen nach Angaben des Weltbiodiversitätsrats der Vereinten Nationen (IPBES) die Tier- und Pflanzenarten, auf die die indigene Volksgruppe der San, die hauptsächlich aus Jägern und Sammlern besteht, traditionell angewiesen ist.
Der Biodiversitätsverlust wirkt sich nach Angaben des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) auch auf die spirituellen und Heilpraktiken der San aus. Beispielsweise ist die dornige Hoodia-Pflanze, die von den San seit Jahrhunderten für medizinische Zwecke genutzt wird, durch den Klimawandel, aber auch durch eine übermäßige Ernte durch die Pharmaindustrie stark bedroht.
Lösungsansätze: Nachhaltige Landwirtschaft und Wiederaufforstung
Namibias Regierung hat der Volksgruppe kommunale Naturschutzgebiete zugewiesen, wie beispielsweise die Nyae Nyae Conservancy im Nordosten des Landes. Hier sollen die kulturellen und wirtschaftlichen Praktiken der San durch Wiederaufforstung, nachhaltige Jagd und Landwirtschaft sowie ökologische Bildungsmaßnahmen geschützt werden.
Landrechte für Indigene als Schlüssel im Kampf gegen Klimawandel
Die indigenen Dayak Tomun aus dem Ort Kinipan auf Borneo kämpfen seit Jahren gegen das Vorrücken von Palmöl-Plantagen und für den Schutz des Regenwaldes, in dem sie leben. In der Region im indonesischen Kalimantan sind einige der letzten Orang-Utans und andere bedrohte Wildtiere heimisch.
Regenwälder spielen für das globale Klima eine ganz entscheidende Rolle: Sie entziehen der Luft Treibhausgase und dienen als riesige Kohlenstoffspeicher. Aber gerade auf Borneo werden riesige Waldgebiete wegen des weltweiten Palmöl-Booms abgeholzt.
Schon seit Jahren versuchen die Dayak Tomun, sich die Rechte an dem Waldgebiet zu sichern. Dafür wurden schon mehrmals alle erforderlichen Dokumente und Gutachten eingereicht - bisher erfolglos. «In der Realität werden indigene Gemeinschaften nur nach großen Anstrengungen und äußerst selten anerkannt, obwohl sie hier lebten, lange bevor es den Staat Indonesien gab», schrieb die Organisation «Rettet den Regenwald». Firmen kämen hingegen leicht an Konzessionen für Holz, Plantagen und Bergbau, ohne dass die Indigenen überhaupt gefragt würden.