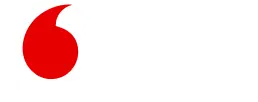Bettlägerig, hilfsbedürftig, kraftlos: ein Szenario, das wir am liebsten verdrängen würden. Aber wie fühlt es sich an, plötzlich ein Pflegefall zu sein? Und wie hart ist der Job eines Pflegers? In einer neuen Doku "Das Jenke-Experimnet" (9. Dezember, 20.15 Uhr, RTL) gibt TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff Antworten auf diese Fragen. Zudem wagt der 54-Jährige einen spannenden Selbstversuch: Er wird für die Sendung zum „Pflegefall“. Im Interview mit GOLDENE KAMERA beschreibt er diese Erfahrung.
Herr von Wilmsdorff, Sie sind bekannt für Ihre Selbstversuche. War das Pflegeexperiment der extremste?
JENKE VON WILMSDORFF: Nein, aber es war definitiv einer der belastendsten für meine Psyche. Denn Pflegebedürftigkeit ist ein Thema, das jeder am liebsten weit von sich wegschieben würde.
Warum trifft das auf jeden von uns zu?
Aus verschiedensten Gründen. Einerseits ist Pflegebedürftigkeit ab einem gewissen Alter für uns alle relevant, aber gleichzeitig berührt es auch unsere Grundängste. Viele Leute würden lieber aus dem Fenster springen, als in einem Pflegeheim zu landen. Außerdem kommt erschwerend hinzu, dass das Pflegesystem kompliziert ist.
Wie war Ihr Praktikum als Pfleger?
Durch meinen Selbstversuch als Pfleger habe ich die Einsicht gewonnen, dass man diesen Beruf nur dann gut ausüben kann, wenn man wirklich ein Menschenfreund ist. Denn man muss sich für andere interessieren und den Pflegebedürftigen trotz großem Zeitdruck ihre Menschenwürde lassen. Außerdem ist der Job körperlich und psychisch belastend – auch deshalb, weil eine derart intensive Auseinandersetzung mit der meist letzten Lebensphase nicht jedermanns Sache ist.
Über die Pflegebranche liest man oft negative Geschichten. Kann man im Heim auch ein gutes Leben führen?
Definitiv. Vor Drehbeginn dachte ich, dass das nicht geht. Aber vorausgesetzt, dass die Umstände und die Umgebung gut sind und man ein passables Pflegeheim findet – was übrigens nicht immer teuer sein muss –, kann man in einer solchen Einrichtung wirklich noch eine schöne Zeit haben.
Sie haben nicht nur ein Praktikum im Pflegeheim gemacht, sondern obendrein die gelähmte Ex-Stabhochspringerin Kira Grünberg als Pflegeassistent betreut. Was war die wichtigste Erfahrung bei dieser Begegnung?
Kira Grünberg zählte zu Österreichs erfolgreichsten Stabhochspringerinnen, die sich nach einem Unfall das Rückgrat gebrochen hat. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt. Das Schöne bei der Begegnung mit Kira war, einen lebenslustigen Menschen kennenzulernen, der sich mit seinem Schicksal arrangiert hat, ein selbstbestimmtes Leben führt und in unserer Sendung verrät, wie sie das geschafft hat. Ich habe Kira Grünberg als Pflegeassistent bei der Körperpflege, beim Anziehen, beim Urinieren und beim Stuhlganz geholfen – was natürlich eine große Hürde war, weil ich dazu den intimsten Bereich eines anderen Menschen geteilt habe.
In Japan sind Sie auf Tuchfühlung mit Pflegerobotern gegangen. Warum?
Weil dort bereits Roboter getestet werden, die theoretisch auch hierzulande zum Einsatz kommen könnten. Wie solche Hilfsmittel funktionieren, wollte ich selbst begutachten. Aber ich hoffe inständig, dass die Robotik niemals echte Pflegekräfte ersetzen wird. Denn das kann sie auch gar nicht, weil es vor allem um Respekt und Würde und Kommunikation und Interesse am Menschen geht. Ansatzweise hat sich diese Einsicht übrigens auch schon in Japan durchgesetzt – glücklicherweise.
Inwiefern?
Ganz einfach. Dort wurde eine „menschliche Waschmaschine“ entwickelt, in die der zu reinigende älteren Menschen in einem Rollstuhl reingeschoben wurde. Anschließend guckte nur noch der Kopf raus, während der Körper wie ein einer Autowaschanlage abgeschrubbt wurde. Doch all diese 50.000 Euro teuren Maschinen wurden wieder abgeschafft. Ja - die Robotik in Japan hat mich wirklich enttäuscht.
Zurück in Deutschland haben Sie dann am eigenen Leib getestet, wie es sich anfühlt, pflegebedürftig zu sein. Wie haben Sie das simuliert?
Ich habe die „Nähe einer Bedürftigkeit“ hergestellt, indem ich mir die Arme habe eingipsen lassen. Außerdem konnte ich meine Beine nicht mehr ohne fremde Hilfe anwinkeln. Das entspricht Pflegegrad fünf, einem Zustand, in dem einem der Hintern abgewischt werden muss.
Wie erging es Ihnen in der Situation?
Zuerst hat mich das runtergezogen. Aber nach kurzer Zeit legte sich meine Zurückhaltung, und ich habe mir beim Pinkeln in Urinflaschen helfen lassen und sogar die größte Hürde genommen, nämlich mich säubern zu lassen. So habe ich noch mehr Verständnis dafür entwickeln können, wie es sich anfühlt, pflegebedürftig zu sein – und mein Respekt vor den Pflegern wuchs ins Unermessliche.
Wie erkennt man ein gutes Pflegeheim?
An ziemlich profanen Dingen: Erstens darf es in einer solchen Einrichtung nirgendwo nach Urin riechen. Zweitens sollte man sich nicht von einer imposanten Lobby blenden lassen, sondern in die Zimmer und Flure der Bewohner schauen. Drittens sollte man mehrere unterschiedliche Bewohner fragen, wie es sich wirklich in dem Heim lebt – und sich selbst ein Bild davon machen, ob die Bewohner den ganzen Tag in ihrem Zimmer hocken oder Gesellschaft haben und beschäftigt werden. Und wenn man schließlich ein gutes Heim gefunden hat, in dem auch noch das Essen stimmt, sollte man nicht glauben, dass man sich den Aufenthalt dort nicht leisten kann – weil einen der Staat im Zweifelsfall durchaus unterstützt. Auch als Mensch mit einer kleinen Rente kann man in ein gutes Heim ziehen, wenn man sich schlau macht, wie das geht. Außerdem ist es wichtig, zu wissen, dass man ein Heim jederzeit wieder wechseln kann, wenn man sich dort nicht wohl fühlt.
Aber was raten Sie den Angehörigen von Menschen, die von einem Tag auf den anderen vom Thema „plötzlich Pflegefall“ betroffen sind?
Als Erstes sollte man versuchen, eine Tagespflege für den Betroffenen zu bekommen, um sich dann in aller Ruhe um ein gutes Pflegeheim zu bemühen. Denn unter zeitlichem Druck gelingt das nur selten. Idealerweise ist ein solcher Platz übrigens in der näheren Umgebung des früheren Lebens – damit sich der Betroffene nicht komplett umgewöhnen muss.