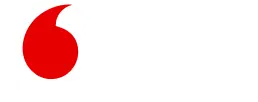Datenschützer contra Krankenkassen
Eins ist klar: Die elektronische Patientenakte wird kommen. Es steht nur nicht fest, wann genau. Erst einmal, so der ursprüngliche Plan der alten Bundesregierung, sollten im Januar 2022 die meisten gesetzlich Versicherten die ePA zumindest theoretisch nutzen können. Zu einem späteren Zeitpunkt sollten dann die privat Versicherten folgen.
Dass der von Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) avisierte Termin nicht einzuhalten war, liegt nicht an dessen Nachfolger Karl Lauterbach (SPD), sondern am Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich Kelber. Er streitet mit vier großen gesetzlichen Krankenkassen über die genaue Ausgestaltung der ePA.
Wer greift auf welche Daten zu?
Kelber, der für 63 gesetzliche Krankenkassen mit 44,5 Millionen Versicherten zuständig ist, hatte die Kassen angewiesen die ePA um zusätzliche Datenschutz-Funktionen zu erweitern, weil die Patientenakte aus seiner Sicht sonst gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen würde. Die Krankenkassen haben dagegen geklagt – Ausgang offen.
Grob gesagt geht es darum, wer genau auf welche Daten zugreifen kann. Die Versicherten sollen nämlich selbst entscheiden, ob sie den Ärzten den Zugriff auf bestimmte Diagnosen, Befunde oder Laborberichte erlauben oder sperren. Der deutsche Gesetzgeber verlangt von den Krankenkassen lediglich dies per Smartphone oder Tablet möglich zu machen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hingegen findet, dass die DSGVO den Kassen vorschreibt das sogenannte „feingranulare Zustimmungs-Management“ für alle Versicherten zu ermöglichen.
Mehrwert für die Allgemeinheit
Dass Herr Kelber beim Datenschutz der ePA genau hinschaut, ist durchaus ehrenwert, denn nichts ist wohl so sensibel wie Gesundheitsdaten, mit denen man Krankenversicherte theoretisch zu „gläsernen Patienten“ machen kann. Eine Horrorvision für die Gegner der ePA ist der ausführliche Zugriff durch die Krankenkassen, die so maßgeschneiderte Tarife oder Bonuszahlungen für besonders gesundheitsförderndes Verhalten anbieten könnten.
In Deutschland, dem Land des ausufernden Datenschutzes, halte ich das persönlich nicht für möglich. Zudem ist es ganz offensichtlich, dass auch die Allgemeinheit von der Einführung der elektronischen Patientenakte profitiert. Hausärzte, Spezialisten, Krankenhäuser – sie alle können sich bei entsprechender Freigabe der Daten durch den Patienten ein viel kompletteres Bild machen und so die bestmögliche Therapie verabreichen. Sinnlose Überweisungen und Doppeluntersuchungen kann man so auch minimieren.
Wirksam im Kampf gegen Corona
Nicht zuletzt im Kampf gegen das Corona-Virus, das uns zwei Jahre nach seinem Auftauchen in Deutschland immer noch piesackt, könnte die ePA ein wirksames Mittel sein. Nicht umsonst hat der Corona-Expertenrat der Bundesregierung kürzlich von der Politik verlangt die Einführung der elektronischen Patientenakte mit höchster Priorität umzusetzen.
Das Zauberwort heißt „anonymisierte Daten“. Mit der ePA ist es möglich eine große Menge von Daten zu sammeln, um daraus möglichst präzise Schlussfolgerungen zu ziehen. Noch ist es ja so, dass ein Mensch, der in Deutschland ins Krankenhaus kommt oder stirbt, im Zweifelsfall dem Corona-Virus zugeordnet wird. In Bayern gilt das sogar für Patienten, die z.B. mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus kommen und bei denen dann dort bei der Routine-Untersuchung Corona festgestellt wird.
Das sind natürlich unhaltbare Zustände. Wie viel weiter wären wir wohl schon in der Pandemie, wenn wir so weit wären wie das weit digitalisierte Estland? Wir könnten ermitteln, welche Vorerkrankungen Corona-Patienten haben, an welcher Varianten des Virus sie genau erkrankt sind oder auch, welche Bevölkerungsgruppen überraschend immun gegen das Virus sind. Die Voraussetzung dafür ist zwar die ausreichende Zahl an PCR-Tests, da simple Antigen-Tests gerade bei der Omikron-Variante ins Leere laufen, aber eine breit angelegte Auswertung von Daten würde schon helfen.
Das kann die ePA
De facto ist die Testphase der ePA, die schon seit Januar 2021 läuft, von der neuen Bundesregierung noch einmal verlängert worden. Zu wenige Praxen und Krankenhäuser sind an das System angeschlossen. Außerdem ist auch der Zuspruch der Patienten relativ gering, zumal eine Teilnahme nicht verpflichtend ist.
Wenn die technischen Voraussetzungen erfüllt sind, können Versicherte zumindest einiger Krankenkasse aber jetzt schon bestimmen, wer worauf Zugriff bekommen soll. Das gilt erst einmal für Befunde, Arztbriefe und Infos zu weiterführenden Behandlungen wie z.B. Physiotherapien. All diese Infos können in die elektronische Patientenakte eingepflegt werden. Warten müssen die Nutzer der ePA noch auf weitere Funktionen. So soll es zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein Gesundheitsdaten wie den Mutterpass, das gelbe Untersuchungsheft für Kinder oder den Impfpass in der elektronischen Patientenakte abzulegen. Persönlich besonders praktisch finden vergessliche Naturen wie ich, dass auch die Hinterlegung des Bonushefts für zahnärztliche Regeluntersuchungen möglich sein soll.
Wer kann die ePA nutzen?
Wer die ePA nutzen möchte, kann bei seiner Krankenkasse einen Nutzungszugang beantragen, dann die entsprechende App herunterladen, sich registrieren und authentifizieren. Das geht beispielsweise bei der BIG direkt gesund klassisch über das Post-Ident-Verfahren der Deutschen Post oder ganz modern per Video-Chat.
Programmiert wurden die Apps der Krankenkassen von Dienstleistern wie beispielsweise IBM. Weder diese Dienstleister noch die Krankenkassen haben jedoch Zugriff auf die in der ePA abgelegten Daten. Diese liegen vielmehr verschlüsselt auf Servern in Deutschland, die europäischen Datenschutzbestimmungen unterliegen. Bei Datenschutzfragen stehen die entsprechenden Beauftragten der jeweiligen Krankenkassen bereit.
Auch wer kein Tablet oder Smartphone besitzt, kann die elektronische Patientenakte nutzen: Er muss sich von der Krankenkasse eine PIN ausstellen lassen und kann sie beim nächsten Arztbesuch in Kombination mit seiner elektronischen Gesundheitskarte befüllen lassen. Das geht über einen Browser oder spezielle Programme, die auf den PCs der Praxen installiert sein müssen.