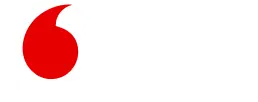Hoffentlich verliere ich meinen Job nicht! Warum bin ich eigentlich immer so schlecht drauf? Wie versorge ich meine pflegebedürftigen Eltern? Solche oder ähnliche Sorgen kennen viele Menschen. Und dass man darüber länger nachdenkt, ist auch nicht ungewöhnlich. Aber meist kommen andere Herausforderungen des Alltags dazwischen und dann lässt man das Thema wieder ruhen - so ist das eigentlich.
Doch bei manchen Menschen nimmt die Grübelei, auch Overthinking genannt, überhand: Sie schlafen schlechter und können kaum an etwas anderes denken. Was dahintersteckt und wie man gegensteuern kann, erklären zwei Expertinnen.
Nachdenken ist etwas anderes
Zunächst einmal: Grübeln ist etwas anderes als intensives Nachdenken über ein Thema. Lösungsorientiertes Nachdenken zum Beispiel ist durchaus positiv. Grübeln dagegen bringt Betroffene meist nicht weiter – im Gegenteil.
«Die Gedanken kreisen um negative Themen», erklärt Julia Funk das Phänomen des Overthinkings. Und sie kreisen immer weiter und dichter - wie eine Spirale.
Den Betroffenen fällt es sehr schwer, sich von den negativen Gedankenspiralen zu lösen. Und etwas kommt noch hinzu: «Die Gedanken gehen dann oft mit einer negativen Bewertung der eigenen Person einher», sagt Funk, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Typische Beispiele: Grübeln über die eigene negative Stimmung - warum geht es mir so viel schlechter als allen anderen? Oder Sorgen um die Zukunft - was wäre, wenn ich meinen Job verliere? In der Forschung wird solches Grübeln repetitives, negatives Denken genannt.
Wann wird Grübeln krankhaft?
Grübeln allein ist zwar noch keine seelische Erkrankung und muss auch nicht zwangsläufig negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Möglich ist das aber, und zwar auf verschiedene Arten.
So grübeln etwa Menschen, die bestimmte psychische Störungen haben, mehr als psychisch gesunde Personen. Und: Die Grübelei kann bei Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangsstörungen, Essstörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen dazu beitragen, die jeweilige Krankheit aufrechtzuerhalten. Das Versinken in negativen Gedanken kann auch ein Symptom für eine Depression sein.
Wiederum haben psychisch gesunde Menschen, die viel grübeln, ein höheres Risiko, psychische Störungen wie Depressionen oder Angsterkrankungen zu entwickeln. Einfach aufhören mit dem Grübeln - das würden viele gern, aber: Grübeln kann zu einer Gewohnheit werden. «Das Gedankenkreisen ist dann an bestimmte Trigger geknüpft», erläutert Funk. Zum Beispiel am Morgen erst zu grübeln, statt aufzustehen.
Zum Grübeln neigten besonders Menschen, die perfektionistisch sind, sagt Christa Roth-Sackenheim. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit einer Praxis in Andernach und zweite Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Psychiater. «Sie überlegen im Nachhinein ständig, was sie hätten besser machen können.»
Und: Auch Menschen, die es nicht ausstehen können, wenn der Tisch nicht aufgeräumt ist oder wenn die Schuhe nicht paarweise stehen, sind eher von Grübelei betroffen. Also Menschen, denen Ordnung wichtig ist.
Manche Menschen grübeln auch, weil sie alles durchdenken wollen, damit sie nicht überrascht werden, wenn etwas Schlimmes passiert. Die Grübelei vermittelt ihnen ein Gefühl von Kontrolle.
Zugleich hält Grübeln Betroffene in einem passiven Zustand - sie finden keine Lösung, kommen nicht ins Tun.
Stopp! So findet man aus der Spirale
Wie können sie aus ihrem Gedankenkarussell aussteigen? In der Psychotherapie gibt es verschiedene Ansätze, die helfen können.
Einer ist die Ruminationsfokussierte Kognitive Verhaltenstherapie. Rumination steht eigentlich für Wiederkäuen, beschreibt hier aber sich wiederholende negative Gedanken. Diese Therapie soll vor allem Menschen mit Depressionen helfen.
Hier wird im ersten Schritt analysiert, wann das Grübeln auftritt. Danach werden andere, hilfreichere Gewohnheiten etabliert. Außerdem bekommen die Betroffenen ein Training in konkretem Denken. Julia Funk erläutert, was dahintersteckt: «Sie führen sich belastende Situationen, über die sie oft grübeln, bildhaft vor Augen und überlegen dann Schritt für Schritt, was sie konkret tun können, um diese Situationen besser zu meistern, statt von einem zum nächsten negativen Gedanken zu springen.»
Ein weiterer Therapieansatz ist die Metakognitive Therapie. Diese Art der Therapie richtet sich vor allem an Menschen, die stark unter Zukunftssorgen leiden und überzeugt sind, alles durchdenken zu müssen, um auf Schlimmes vorbereitet zu sein.
Hier wird zunächst die Frage bearbeitet, mit welchem Ziel die Betroffenen grübeln und ob das Grübeln tatsächlich diesen Zweck - vorbereitet zu sein - erfüllt. Außerdem sollen sie sich täglich 15 Minuten «Grübelzeit» reservieren, aber möglichst außerhalb dieser Zeit nicht grübeln. «Diese zeitliche Begrenzung schafft Entlastung», sagt Funk.
Sinnvoll sind außerdem achtsamkeitsbasierte Ansätze. Entsprechende Übungen oder Trainings richten den Blick auf das Hier und Jetzt, was eine hilfreiche Strategie gegen das Gedankenkreisen sein kann. Dazu kann gehören, dass man seine Gedanken vorüberziehen lässt wie Wolken am Himmel oder vorbeifahren lässt wie Autos auf einer Straße. Solche Vergleiche können helfen, sich klarzumachen: Gedanken sind etwas Flüchtiges.
Grübelzwang versus Zwangsgedanken
Vom pathologischen Grübeln, also der Rumination, abgrenzen lassen sich sogenannte Zwangsgedanken. Julia Funk erklärt die Unterschiede: «Zwangsgedanken treten oft in Form von mentalen Bildern auf, beim Grübeln sind die Gedanken eher verbal.»
Außerdem sind Zwangsgedanken häufig ich-dyston, wie Fachleute sagen. Betroffene haben dann das Gefühl, als würden diese Gedanken nicht zu ihnen gehören. Auch das ist beim Grübeln anders.
Und: «Zwangsgedanken sind oft mit einem konkreten Handlungsdrang verbunden», erklärt Funk. Zum Beispiel, sich beim Gedanken an Schmutz die Hände zu waschen.